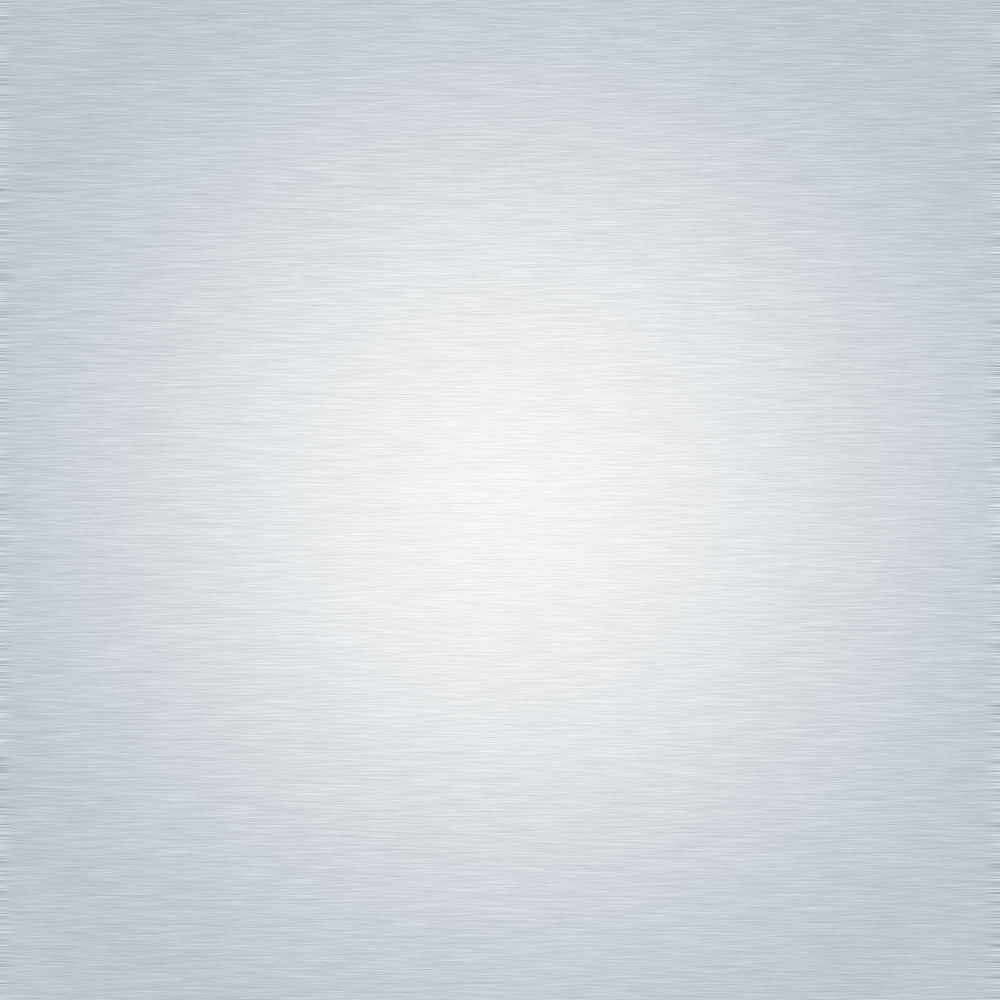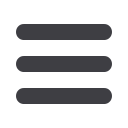

49
Uni-Journal Jena04/15
Skat spielen in der letzten Reihe
Mein 1. Semester: Prof. Dr. Wolfgang Dahmen
Wie haben Sie Ihr 1. Semester erlebt?
An mein erstes Semester (Winter-
semester 1968/69) kann ich mich noch
sehr gut erinnern, ich weiß sogar noch
meinen Stundenplan auswendig: be-
ginnend montags um 13.30 Uhr mit ei-
nem mittellateinischen Lektürekurs und
endend freitags um 15 Uhr mit einem
Proseminar zur alten Geschichte. Meine
Studienfächer waren Romanistik (Fran-
zösisch), Geographie und Geschichte,
das Ganze mit dem Studienziel „Lehrer
am Gymnasium“.
Gebürtig und aufgewachsen in Düs-
seldorf begann ich mein Studium in Köln,
der damals nächstgelegenen Universi-
tätsstadt, wo auch schon mein älterer
Bruder studierte. Da er in einem Stu-
dentenheim wohnte, bewarb ich mich
dort um ein Zimmer, das ich aber erst
zu Beginn meines zweiten Semesters
bekam – ich wohnte also zunächst wei-
ter bei meinen Eltern und musste täglich
mit dem Zug nach Köln pendeln.
Was hat Ihnen beim Eingewöhnen in
den Lebensraum Universität geholfen
und wo gab es Probleme?
Dieses erste Semester war so etwas
wie ein Übergang vom Status des Schü-
lers zu dem des Studenten. Ab dem
zweiten Semester, als ich in fußläufiger
Distanz zur Universität wohnte, habe
ich die Angebote sowohl universitärer
Art (Vorträge etc.) als auch des studen-
tischen Kneipenlebens dann intensiver
ausgenutzt. Die Integration in den Le-
bensraum Universität war im ersten Se-
mester also sicherlich noch ungenügend.
Waren Sie chaotisch oder bestens or-
ganisiert? Einzelkämpfer oder Grup-
penlerner?
Am Anfang fühlte ich mich ziemlich
unsicher: Da es in Nordrhein-Westfalen
wegen der Umstellung des Schuljahres-
beginns vom Frühjahr auf den Herbst
Kurzschuljahre gegeben hatte, hatte ich
kurz nach meinem 18. Geburtstag Abi-
tur gemacht. Oft fühlte ich mich noch zu
jung oder unreif für die Universität, und
dass man als „Jungspund“ erst einmal
kleine Brötchen zu backen hatte, ließen
einen die älteren Semester durchaus
spüren. Hinzu kam für mich eine andere
Ungewissheit: Dadurch, dass ich so früh
hatte Abitur machen können, war ich zu
Studienbeginn noch nicht gemustert
worden; ich studierte also mit der Angst,
unter Umständen bald mein Studium un-
terbrechen und zur Bundeswehr gehen
zu müssen. So war die Musterung, die
gegen Ende des
ersten Semesters
erfolgte, in der Tat
die härteste Prü-
fung des ersten
Semesters – er-
freulicher weise
habe ich gerade
diese als einzige
nicht bestanden...
Da es zu dieser
Zeit noch keine
F o t o k o p i e r g e -
räte gab, musste
vieles, das man
gelesen hatte,
schriftlich exzer-
piert werden. Ich
erinnere mich,
dass ich Freistun-
den gerne dazu
genutzt habe, in
der Bibliothek die Inhaltsangaben von
Romanen oder Theaterstücken aus
Kindlers Literaturlexikon einfach abzu-
schreiben. Und da uns ein Dozent aus
der Romanistik gesagt hatte, dass man
pro Semester etwa 1 500-2 000 Seiten
französischer Literatur lesen müsse,
habe ich mich gezwungen, jeden Tag
mindestens 10 Seiten zu lesen. Dies war
zuweilen schon eine Herausforderung,
und manches Mal habe ich mich gewun-
dert, was in der Zusammenfassung in
Kindlers Literaturlexikon über das Werk
stand, das ich gerade „geschafft“ hatte.
Was war das Wichtigste/Beste am
ersten Semester?
Als ich zur Schule ging, war Koeduka-
tion noch ein Fremdwort, d. h. sowohl
die Grundschule wie auch das Gymna-
sium waren getrenntgeschlechtlich. Nun
kam ich in Vorlesungen und Seminare,
in denen auch junge Damen saßen, und
das in einem Fach wie der Romanistik, in
dem männliche Studierende traditionell
eine verschwindend kleine Minderheit
sind…
Von den Kommilitoninnen, die ich im
ersten Semester kennengelernt habe,
weiß ich heute zwar noch den einen
oder anderen Namen, doch Kontakt
habe ich zu keiner von ihnen mehr. Da-
gegen sind Freundschaften mit Kommi-
litonen entstanden, die bis heute halten.
Ich denke da vor allem an zwei Roma-
nisten: Der eine fuhr mit mir regelmäßig
im selben Zug von Düsseldorf nach Köln,
mit dem anderen habe ich im Prosemi-
nar zur alten Geschichte in der letzten
Reihe Skat gespielt, wenn es vorne zu
langweilig war – er hatte dann bis zu
seiner Emeritierung einen Lehrstuhl am
Romanischen Seminar einer hessischen
Universität.
Sind Sie immer zu allen Vorlesungen
gegangen?
Ja. Zwar hatte ich schon im ersten Se-
mester in manchen Lehrveranstaltungen
das Gefühl, dass sie mir nichts bringen,
doch den Mut, dann einfach nicht mehr
hinzugehen, hatte ich erst später (außer-
dem gab es ja die Alternative des Skat-
spielens). Vielleicht lag das aber auch an
Folgendem: Als ich mein Studium be-
gann, musste man noch Gebühren für
jede belegte Lehrveranstaltung bezahlen
(2,50 DM pro SWS), die meine Eltern für
mich übernahmen. Ich glaube, ich hätte
es als unfair ihnen gegenüber betrach-
tet, wenn sie für etwas bezahlen, was
ich nicht in Anspruch nehme.
Dachten Sie mal daran aufzugeben?
Nein. Es gab natürlich Momente, in
denen ich weniger Gefallen am Studium
fand, aber so schlimm, dass ich ernsthaft
erwogen hätte, ganz hinzuschmeißen,
war es weder im ersten Semester noch
in der Folgezeit.
Was stand neben dem Studienplan
auf Ihrem Programm?
Wenig, was mit der Universität zu tun
hatte: etwa Aktivitäten in der katholi-
schen Jugend und regelmäßige Besuche
am Wochenende bei den Düsseldorfer
Sportmannschaften (Fußball: Fortuna
Düsseldorf, Eishockey: Düsseldorfer
EG).
FSU intern
DasersteSemes-
tervermerktim
Studentenausweis:
WolfgangDahmen,
heuteProfessorfür
RumänischePhilolo-
gie,nahmimHerbst
1968seinStudium
anderUniversitätzu
Kölnauf.
Foto:Kasper